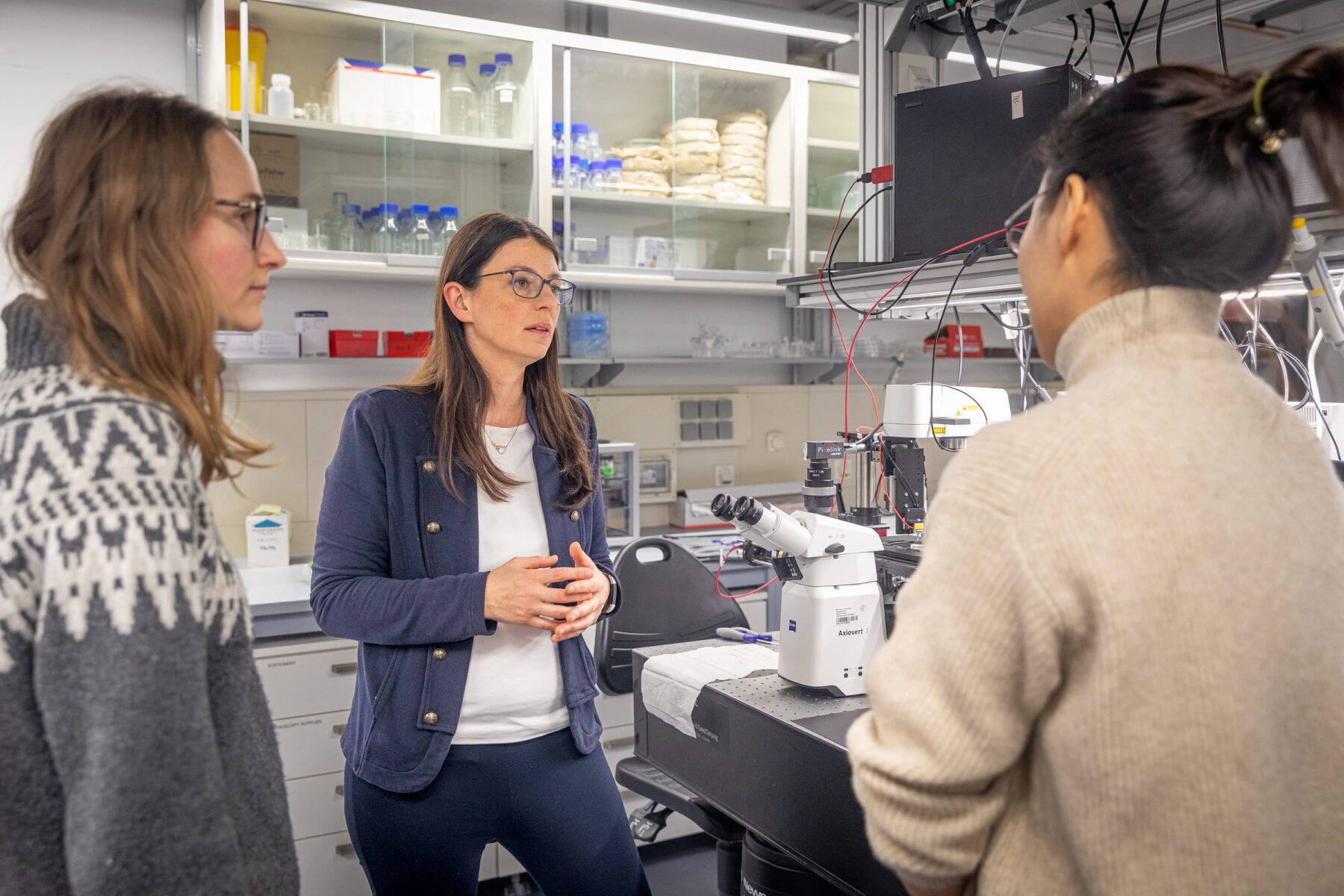
Standortbotschafterin Silvia Vignolini – »Brandenburg hat einen starken Standort für Technologie und Materialwissenschaften«
Prof. Silvia Vignolini erforscht, wie Pflanzen und Tiere durch winzige Oberflächenstrukturen Farben entstehen lassen. Dieses Wissen nutzt sie, um nachhaltige Pigmente und neue Materialien zu entwickeln. Für den Potsdam Science Park sieht sie eine Zukunft in den Materialwissenschaften, die viele nachhaltige Innovationen ermöglichen könnte.
Lassen sich die intensivsten Farben der Natur – wie das Ultraweiß von Käfern oder das tiefe Blau schillernder Beeren – mit biologisch abbaubaren Materialien nachbilden? Silvia Vignolini erforscht, wie Pflanzen und Insekten auf geniale Weise leuchtende Farben erzeugen. Der Cyphochilus-Käfer zum Beispiel erscheint auffallend weiß, weil er das Licht sehr effizient reflektiert. Dieser Effekt ist auf eine Nanostruktur zurückzuführen – eine mikroskopische Anordnung von Materialien, die das Licht auf kleinster Ebene manipulieren. Auch die Pollia condensata-Beere schimmert in einem leuchtend-metallischen Blau, und zwar nicht aufgrund von Pigmenten, sondern aufgrund winziger Zellulosestrukturen in ihrer Schale, die das Licht auf eine bestimmte Weise streuen. Die Natur nutzt diese mikroskopischen Strukturen meisterhaft, um atemberaubende Farben zu erzeugen. Silvia Vignolini will diese natürlichen Innovationen nutzbar machen.
»Wir wollen verstehen, wie es lebenden Organismen gelingt, Material auf einer Skala von wenigen hundert Nanometern so zu manipulieren und zu formen, dass es diese eindrucksvollen Strukturfärbungen hervorbringen kann«, sagt Silvia Vignolini, die seit 2023 Direktorin am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung (MPIKG) im Potsdam Science Park ist und dort die Arbeitsgruppe Nachhaltige und Bio-inspirierte Materialien leitet.
Zum Vergleich: 100 Nanometer entsprechen etwa einem Tausendstel eines menschlichen Haares. Silvia Vignolini und ihr Team erforschen also hochkomplexe Architekturen auf einer unvorstellbar kleinen Skala. Was sich an diesen kleinsten Architekturen beobachten lässt: Die Haut der Pollia condensata-Beeren erhält ihren metallisch blauen Glanz durch winzige Zellulosefasern, die wie die Stufen einer Wendeltreppe in Schichten angeordnet sind. Diese besondere Struktur, die so genannte Helikoidstruktur, reflektiert das Licht in tiefem Blau und anderen Farben und sorgt so für den auffälligen, schimmernden Effekt der Beere.

Biologische Prozesse kontrollieren, um nachhaltige Farben zu entwickeln
Es geht Silvia Vignolini nicht nur darum, die biologischen Prozesse zu verstehen, die Strukturfärbung erschaffen – sie will sie auch nutzen. »Wenn man die Prozesse versteht, kann man sie kontrollieren und im Prinzip auch nachbauen«, sagt Vignolini. Für diese besondere Expertise ist ihre Arbeitsgruppe bekannt. Die Forschenden können Zellulose aus Holzspänen oder Baumwolle gewinnen und daraus kleinste Faserteilchen isolieren, so genannte Cellulose-Nanokristalle, die sie ihnen als Bausteine dienen. Um eine ähnliche Architektur wie in den Beeren nachzubilden, verarbeiten sie diese Bausteine im Wasser so, dass die strukturelle Färbung entsteht. »Es erscheint wie Magie, wenn sich die Faserteile zu ihren Strukturen zusammenfügen, aber es lässt sich mit Physik beschreiben«, sagt Vignolini.
Die Forschung von Prof. Vignolini und den Wissenschaftler:innen am MPIKG könnte zukünftig auch für die Farbindustrie neue Wege bereiten. Denn anders als herkömmliche Farben, die oft auf giftigen Pigmenten basieren, sind die bio-inspirierten Farben biologisch abbaubar und sogar essbar. Zudem stammen Biopolymere wie Zellulose, Lignin oder Chitin aus erneuerbaren und teils recycelten Rohstoffen und sind somit für die Industrie eine vielversprechende nachhaltige und klimaschonende Alternative zu synthetischen Farben.
![Prof. Silvia Vignolini, Direktorin Nachhaltige und Bio-inspirierte Materialen am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung (MPIKG) auf dem Max-Planck-Campus im Potsdam Science Park ©Standortmanagement Golm GmbH/sevens[+]maltry](https://potsdam-sciencepark.de/wp-content/uploads/2025/04/POTSDA2-1800x1200.jpg)
Vita Prof. Silvia Vignolini
Von der Natur inspirierte Spin-offs
Silvia Vignolini ist eine leidenschaftliche Grundlagenforscherin, die Physik, Chemie und Biologie verbindet, um die von der Natur optimierten Konstruktionsprinzipien zu verstehen. Doch sie hat immer auch den Nutzen ihrer Erkenntnisse im Blick. Schon bevor sie in den Potsdam Science Park gekommen ist, während Ihrer Zeit als Professorin an der University of Cambridge, gründete sie zwei Spin-Offs: Sparxell und Seprify. Sparxell nutzt Cellulose-Nanokristalle, um nachhaltige Pigmente herzustellen. Seprify produziert weiße Pigmente auf der Basis von Zellulose, die von den Fasern des Cyphochilus-Käfers inspiriert sind. »Diese Pigmente können auf sichere Weise Titanoxid ersetzen, das früher in vielen Tabletten und Lebensmitteln verwendet wurde, das aber vor kurzem in Europa verboten wurde, weil es potenziell krebserregend ist.«
Im Potsdam Science Park will die aus Italien stammende Physikerin ihre Grundlagenforschung langfristig verwurzeln und neue Fragen vorantreiben, die möglicherweise auch in die Gründung eines Spin-offs münden könnten – eines Start-up-Unternehmens aus der Wissenschaft. Die Bedingungen dafür seien hervorragend. »Das Max-Planck-Institut bietet mir viel Freiheit, um Projekte langfristig zu entwickeln, und einen wirklich guten Zugang zu einer exzellenten Infrastruktur«, sagt Vignolini.
Neben nachhaltigen Farben will Vignolini mit ihrem Team auch neue Hybridmaterialien entwickeln, die sich Einzeller zunutze machen, um optische Funktionen herzustellen. »Wir können zum Beispiel mit Hilfe von Bakterien Licht manipulieren, um Farben zu erzeugen, die auf die Umgebung reagieren«, erklärt Vignolini. »Das ist ein guter Weg, um biologisch abbaubare Materialien mit radikal neuen Funktionalitäten auf nachhaltige Weise herzustellen.« In Zukunft könnten so zum Beispiel Computer Rechenoperationen auf der Basis von Licht durchführen, das vollständig auf organischen Systemen beruht.
Der Potsdam Science Park bündelt eine starke Expertise in den Materialwissenschaften
Durch Kooperationen mit der Universität Potsdam, wo es einen Schwerpunkt zu polymerbasierten Biomaterialien gibt, sowie mit dem direkt gegenüber liegenden Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerforschung IAP verfügen die Wissenschaftler:innen im Potsdam Science Park über die institutionen- und fächerübergreifende Expertise in den Materialwissenschaften, die es braucht, um große Herausforderungen anzugehen, relevante Forschung in die Wirtschaft zu tragen – und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
»Wenn man gute Wissenschaft betreibt, ermöglicht man es jungen Forschenden, Ideen zu entwickeln, die eines Tages wirklich nützlich und wichtig für die Gesellschaft sein könnten.«
Die zunehmende Expertise bringe auch exzellente Fachkräfte aus den Materialwissenschaften in den Potsdam Science Park. »Der Welcome Service des Standortmanagements ist sehr hilfreich, um ihnen in Potsdam einen guten Start zu ermöglichen«, sagt Vignolini. »Als Ausländer ist es nie einfach, sich in eine neue Gesellschaft zu integrieren. Das Gefühl, willkommen zu sein, ist daher äußerst wichtig.« In ihrem Team, in dem Forscher:innen aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, hätten vielen von diesem Angebot profitiert.
»Brandenburg hat einen starken Standort für Technologie und Materialwissenschaften.«
»Es ist sehr wichtig, dass wir in der Region weiter gemeinsame Schwerpunkte setzen und diese stärken«, sagt Vignolini, die ganz in der Nähe lebt. »Der Potsdam Science Park wird bald die kritische Masse an Expertise in den Materialwissenschaften erreichen, damit die Forschung vor Ort auch in die Anwendung überführt werden kann.«
Die Projekte der Standortmanagement Golm GmbH im Potsdam Science Park werden kofinanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Brandenburg.
Text: Mirco Lomoth | Fotografie: sevens[+]maltry